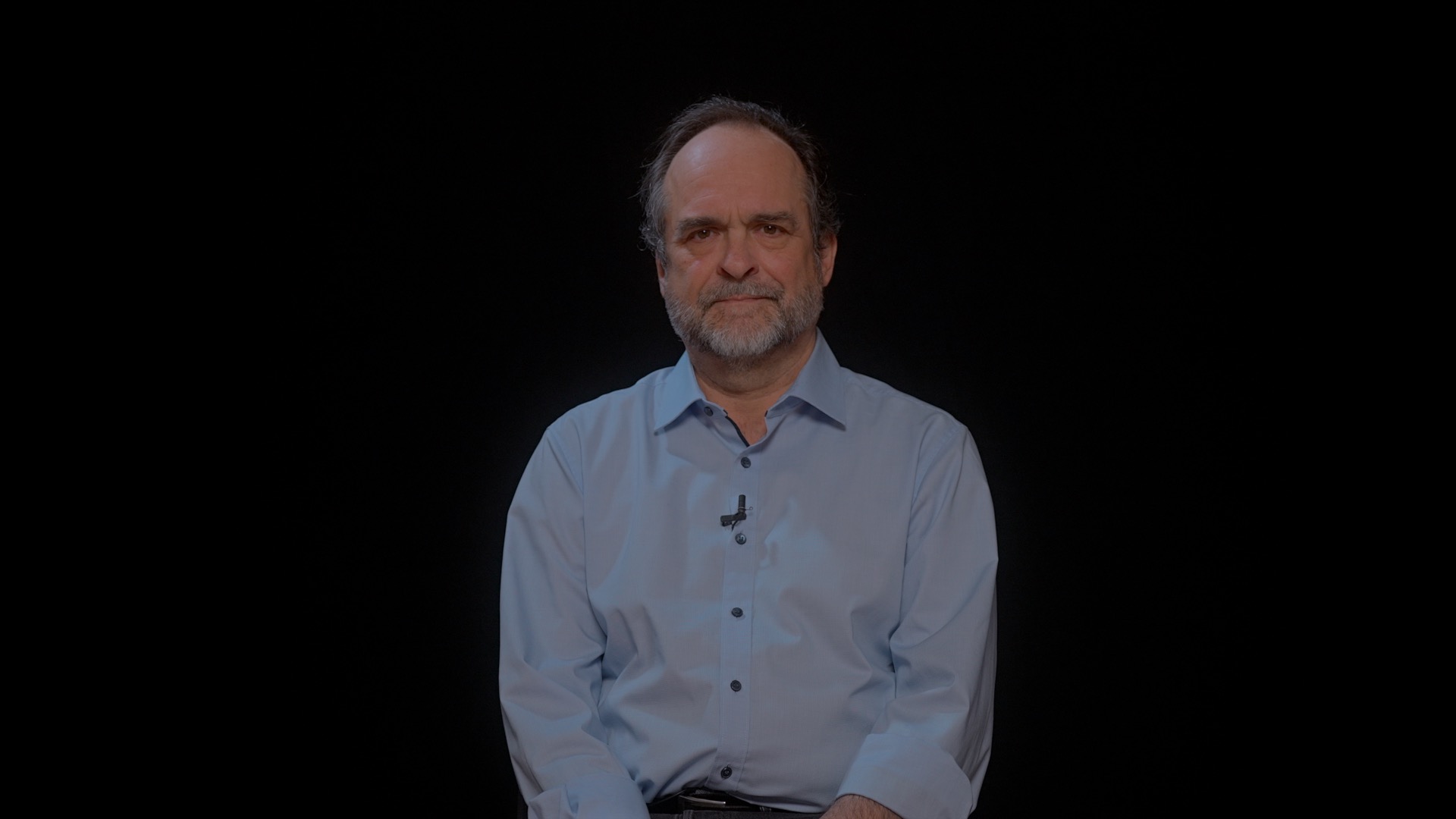Das Projekt KOLOT – קולות – STIMMEN wurde 2024 als dokumentarisches und künstlerisches Vorhaben gegründet. Seither sammelt es Stimmen und entwickelt daraus narrative Videointerviews, die die Folgen der Massaker thematisieren und die Wirkung von Gewalt in jüdischen Biografien nachzeichnen. Die im Rahmen von KOLOT produzierten Videos sind zeitgeschichtliche Zeugnisse jüdischen Lebens in Deutschland nach dem 7. Oktober 2023.
Für die Wiedergabe wird eine stabile Internetverbindung empfohlen.
About
Der 7. Oktober 2023 markiert eine tiefe Bruchstelle für die jüdische Gemeinschaft.
2024 gründete Marina Chernivsky das Projekt KOLOT, mit dem Ziel, ein zeitgeschichtliches Archiv zu entwickeln. In narrativen Videointerviews reflektiert das Projekt die Folgen des terroristischen Angriffs und beleuchtet die Gleichzeitigkeit und Nachwirkungen von Gewalt in jüdischen Biografien.
Das mit dem ELNET Award 2025 ausgezeichnete Projekt KOLOT zählt zu den ersten in Deutschland und Europa, die sich in dokumentarischer und künstlerischer Form mit dem 7. Oktober 2023 und seinen Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft auseinandersetzen.
Die im Rahmen des Projekts entstandenen Videos bilden ein Mosaik persönlicher Erzählungen – individuelle Stimmen, die zugleich kollektive Zeugnisse jüdischen Lebens in Deutschland nach dem 7. Oktober 2023 abbilden.
KOLOT ist aus dem Anspruch der Zeugenschaft heraus entstanden und aus dem Bewusstsein einer Verantwortung: jüdische Stimmen hör- und sichtbar zu machen und sie zu bewahren. Indem den Erfahrungen sprachlich und medial Ausdruck verliehen wird, entsteht ein Akt der Selbstermächtigung.
Eröffnet wurde das Projekt im Oktober 2024 mit einer Auftaktveranstaltung im Jüdischen Museum Berlin. Im August 2025 werden die ersten Interviews erstmals in voller Länge veröffentlicht. Im November 2025 verlieh ELNET den Preis in der Kategorie Kultur an KOLOT.
Die Videointerviews von KOLOT gehen in die Sammlung des Jüdischen Museums Berlin ein. Das Projekt knüpft damit an die Tradition der oral history an, um jüdisches Erinnern als Zeugenschaft und als aktive Praxis festzuhalten.
Geplant sind 20 Videointerviews. Die Fortsetzung des Projekts ist angestrebt.
Das Projekt wird von OFEK e.V. getragen und durch die Förderung des Bundesministeriums des Innern ermöglicht.

Materialien
Mehr Informationen folgen demnächst.
OFEK
Der Trägerverein von KOLOT, OFEK e.V., ist die erste Fachberatungsstelle in Deutschland, die auf Antisemitismus und Communitybasierte Betroffenenberatung bei Gewalt und Diskriminierung spezialisiert ist. OFEK arbeitet bundesweit und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: 1.) fallbezogene Betroffenenberatung, 2.) Stärkung und Empowerment der Community, 3.) antisemitismuskritische Beratung für Institutionen, 4.) Advocacy und fachpolitische Interessensvertretung.
OFEK ist erreichbar über die bundesweite Hotline und verfügt über Beratungsstandorte in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (im Aufbau). OFEK berät vertraulich und kostenfrei zum Umgang mit antisemitischen Vorfällen. Die Beratung von Betroffenen orientiert sich an den fachspezifischen Qualitätsstandards professioneller Opfer- und Antidiskriminierungsberatung. OFEK leistet Beratung zu rechtlichen Möglichkeiten im Umgang mit Antisemitismus, psychosoziale Betroffenenberatung bei Vorfällen und psychologische Beratung und Krisenintervention, fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit und vermittelt bei Bedarf professionelle weiterführende Angebote. OFEK berät ungeachtet der strafrechtlichen Relevanz, stärkt die Ratsuchenden, richtet den Blick auf Handlungsmöglichkeiten und berücksichtigt in der Beratung familienbiografische Erfahrungen mit Antisemitismus und Diskriminierung. Fallbezogene Beratung ist stets parteiisch im Auftrag der Betroffenen und orientiert sich an ihren Wünschen und Bedürfnissen. Alle Angebote können auf Deutsch, Hebräisch, Russisch und Englisch in Anspruch genommen werden.
OFEK bietet darüber hinaus stärkende Gruppenberatung und passgenaue Empowerment-Formate an und leistet Awareness-Begleitung von Veranstaltungen. An Institutionen im Kultur- und Bildungsbereich, Verwaltungen und zivilgesellschaftliche Träger:innen richten sich OFEK-Formate der institutionellen Fachberatung zu Schutzkonzepten, Notfallplänen und Interventionsmanagement sowie zahlreiche Weiter- und Fortbildungsformate.
Mehr zu OFEK:
Presse
Presseanfragen: presse@ofek-beratung.de | +49 176 46 29 46 08
KOLOT in den Medien:
Es braucht nur Mut. Jüdische Allgemeine, 26.11.2025 (Link)
CPPD-Podcastfolge ERINNERUNGSFUTUR: Nicole Schweiß im Gespräch mit Marina Chernivsky. DialoguePerspectives Podcast, 04.09.2025 (Spotify | Apple Podcasts)
Über die Zäsur sprechen. Jungle World, 21.08.2025 (Link)
KOLOT – קולות – Jüd:innen in Deutschland die Stimme(n) zurückgeben. Radio Corax, 07.08.2025 (Link)
Das »Ofek«-Projekt »Kolot« dokumentiert Erfahrungen von Jüdinnen und Juden aus Deutschland nach dem 7. Oktober 2023. Jüdische Allgemeine, 07.08.2025 (Link)
Psychologin: Seit 7. Oktober leben Juden in “paralleler Realität”. Katholische Nachrichtenagentur, 06.08.2025 (Link zum Artikel in der Evangelischen Zeitung)
Projekt „Kolot“: Jüdinnen und Juden erzählen von Erfahrungen nach dem 7. Oktober. Deutschlandfunk/Tag für Tag, 06.08.2025 (Link).
Videoprojekt sammelt deutsch-jüdische Stimmen zum Nahostkonflikt. WDR 3 Mosaik, 06.08.2025 (Link)
OFEK startet Portal mit jüdischen Stimmen zu den Folgen des 7. Oktober. Evangelischer Pressedienst, 04.08.2025 (Link zum Artikel in der Jüdischen Allgemeine)
Gesammelte Stimmen – Projekt „Kolot“ erfasst Zeugnisse zum 7. Oktober. Deutschlandfunk Kultur/Aus der jüdischen Welt, 28.02.2025 (Link)
Impressum
Angaben gemäß §5 TMG
OFEK e.V. Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
Vereinsregister: VR 37581 B
Steuernummer: 27 / 674 / 51693
Veranwortliche im Sinne des Presserechts: Marina Chernivsky
Kontakt:
Tel: +(49) (0) 30 221 84 076
Email: kontakt[at]ofek-beratung.de
Postfach 58 03 16
10413 Berlin
Vertretungsberechtigte Personen im Vorstand/Geschäftsführung:
Marina Chernivsky, Vorstand und Geschäftsführung
Tel: (+49) (0)176 22508407
Email: chernivsky[at]ofek-beratung.de
Postfach 58 03 16
10413 Berlin
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutzerklärung
Stand: 17. Juni 2025
Verantwortlicher
OFEK e.V. Beratungstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
Vereinsregister: VR 37581 B
Umsatzsteuer-Indentifikationsnummer: 27 / 674 / 51693
Postfach 58 03 16
10413 Berlin
Vertretungsberechtigte Personen: Geschäftsführung: Marina Chernivsky
E-Mail-Adresse: kontakt[at]ofek-beratung.de
Telefon: (+49) (0)30 221 84 076
Kontakt Datenschutzbeauftragter
datenschutz@ofek-beratung.de
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Diese Internetseite verwendet teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Mithilfe des Cookie-Banners können Sie sich zu Beginn Ihres Besuchs und jederzeit über die von uns und unseren Dienstleistern eingesetzten Cookies informieren und einstellen welche Cookies verwendet werden dürfen bzw. Ihre Einwilligung zum Einsatz von Cookies erteilen, soweit dies rechtlich erforderlich ist.
Außerdem können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Internetseite eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Grund des berechtigten Interesses des Anbieters gespeichert. Der Anbieter hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.
Datenverarbeitung im Rahmen von Presseanfragen und allgemeinen Anfragen
Zur Beantwortung von Presseanfragen an presse[at]ofek-beratung.de und allgemeinen Anfragen an kontakt[at]ofek-beratung.de verarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten um Kontakt mit Ihnen herstellen und Ihre Fragen beantworten zu können:
- Namen
- Adressen, Telefonnummern
Wir verarbeiten diese Daten auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO da es in unserem berechtigten Interesse liegt Öffentlichkeitsarbeit im direkten Kontakt mit entsprechend interessierten Stellen zu betreiben.
Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Rahmen können Sie jederzeit widersprechen. Dafür stehen Ihnen die oben angegebenen Kontakte zur Verfügung.
Die Daten werden gelöscht sobald Ihre Anfragen umfassend beantwortet worden sind.
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
- Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles: Der Zugriff auf unser Onlineangebot wird in Form von sogenannten „Server-Logfiles“ protokolliert. Zu den Serverlogfiles können die Adresse und der Name der abgerufenen Webseiten und Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmengen, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und im Regelfall IP-Adressen und der anfragende Provider gehören. Die Serverlogfiles können zum einen zu Sicherheitszwecken eingesetzt werden, z. B. um eine Überlastung der Server zu vermeiden (insbesondere im Fall von missbräuchlichen Angriffen, sogenannten DDoS-Attacken), und zum anderen, um die Auslastung der Server und ihre Stabilität sicherzustellen; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) am sicheren Betrieb des Onlineangebots. Löschung von Daten: Logfile-Informationen werden für die Dauer von maximal 30 Tagen gespeichert und danach gelöscht oder anonymisiert. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
- 1&1 IONOS: Leistungen auf dem Gebiet der Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur und verbundenen Dienstleistungen (z. B. Speicherplatz und/oder Rechenkapazitäten); Dienstanbieter: 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) an der technischen Bereitstellung des Onlineangebots; Website: https://www.ionos.de; Datenschutzerklärung: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy. Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.ionos.de/hilfe/datenschutz/allgemeine-informationen-zur-datenschutz-grundverordnung-dsgvo/auftragsverarbeitung/.
Rechte der betroffenen Personen
Rechte der betroffenen Personen aus der DSGVO: Ihnen stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbesondere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben:
- Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
- Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.
- Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
- Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
- Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu fordern.
- Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Vorgaben der DSGVO verstößt.
Änderung und Aktualisierung
Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z. B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.
Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von Unternehmen und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die Adressen sich über die Zeit ändern können und bitten die Angaben vor Kontaktaufnahme zu prüfen.
Zum ersten war am 7. Oktober der absolute Schock dieses Bewusstsein, als mir das bewusst wurde, es ging schrittweise. Und dann, in den darauffolgenden Tagen, als sich das festsetzte und einem klar wurde: So ist jetzt die Realität und es ist jetzt ganz, ganz, ganz anders. Das war ein Gefühl, das bis heute anhält. Und deswegen sage ich, dass der 7. Oktober bis heute dauert und wahrscheinlich noch länger dauern wird. Der 7. Oktober wird immer da sein, der ist nicht vorbei. Und am 8. Oktober morgens klingelte bei mir das Telefon. Eine ehemalige Kollegin war dran und sie hat mich gefragt: „Na, Wenzel, wie war dein Wochenende?“ Und da habe ich gesagt: „Na ja, komische Frage.“ Und Sie?: „Warum denn? Warum? Was ist denn? Was ist denn passiert?“ Und da hat sie gesagt: „Ach so, ja, Hm aber“ Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist, was seit dem 7. Oktober in meiner Umgebung passiert ist, dass die Leute gesagt haben: Naja, das war ja schrecklich, aber die haben ja einen Grund gehabt.“ Es war in einem Kontext zu sehen.
Das ist etwas, was mich sehr verstört hat, was mich wütend gemacht hat, was mich enttäuscht hat und wodurch ich eigentlich auch, ähm die meisten meiner Bekannten und Freunde verloren habe, mit denen ich jetzt auch gar keinen Kontakt mehr habe, weil es kein gemeinsames Verständnis gibt. Aber es hat auch noch viel mehr gezeigt. Es hat gezeigt, dass es vorher anscheinend auch kein gemeinsames Verständnis gab, sondern ein Nebeneinanderleben und dann vielleicht auf gewissen oberflächlichen Ebenen Gemeinsamkeiten, aber die nicht wirklich tief gingen.
Am meisten aber natürlich hat mich berührt und immer noch das Schicksal der Leute, die darunter wirklich gelitten haben, also die auf dem Musikfestival umgebracht worden sind, die Angst hatten, die als Geiseln genommen wurden, die aus ihren Kibbuzim, aus ihren Häusern gerissen wurden, deren Familien umgebracht worden sind. Diese ganzen furchtbaren Geschichten, die man fast gar nicht lesen kann und den man fast gar nicht zuhören kann, weil sie so unglaublich furchtbar sind. Das hat bei mir, das war bei mir eine Zäsur. Ich war vorher in einer Menschenrechtsorganisation bei Human Rights Watch Deutschlanddirektor. Und dass diese Welt keine Antwort gefunden hat auf die Taten, die passiert sind und auch nicht auf die Emotion und der Einbruch ins Leben von Juden und Leuten, die sich denen solidarisch fühlen gegenüber.
Die Konsequenz habe ich daraus gezogen, habe diese Welt verlassen und bin jetzt eben in einer Welt, in der ich mich ganz um den Kampf gegen den Antisemitismus widme. Der Schnitt ist das Massaker. Was da passiert ist und die Solidarität, die die Täter erfahren haben auf der ganzen Welt bis heute. Die Propaganda, die auf so fruchtbaren Boden gefallen ist, dass selbst unsere Kulturinstitutionen und inklusive der Medien davon eingenommen sind und dadurch die Propaganda und die Lügen weiter verbreiten und dafür sorgen, dass Antisemitismus wieder zum Mainstream gehört.
Als Familie sind wir, glaube ich, dadurch stärker noch zusammengerückt. Ich glaube, so geht es vielen Leuten. Nicht umsonst wird der nächstjährige 27. Januar der Holocausttag von Yad Vashem, dem Thema gewidmet: „Familien im Holocaust“. Denn in dieser Not merkt man, wenn um einen herum alles zusammenbricht, dass die Familien der Anker sind und man sich gegenseitig hilft. Aber individuell wurden meine Familienmitglieder natürlich, wo auch immer sie waren. Meine Kinder haben studiert und gearbeitet, an verschiedenen Orten, mitgerissen von dieser antisemitischen Welle. Und sie mussten dann jeweils an ihrem Ort, wo sie waren, Antworten finden. Also zum Beispiel hat mein jüngster Sohn in London an der Universität aggressivste Ablehnung und aggressivsten Judenhass erleben müssen und die Konsequenz gezogen hat, war, sich mit anderen jüdischen Studenten zusammenzutun. Und in diesen Kreisen bewegt er sich jetzt.
Also man findet zusammen. Freunde, Familie, Freunde werden wie Familienmitglieder. Man findet zusammen mit den Menschen, von denen man weiß, dass sie Ähnliches empfinden und Ähnliches innerlich durchmachen. Das ist eine tolle Sache, aber es ist auch ein bisschen erschreckend, denn es führt zu einer freiwilligen Ghettoisierung und wir dachten eigentlich, dass wäre überwunden, aber da müssen wir jetzt arbeiten, daran, dass wir wieder zurückfinden.
Aber wohin sollen wir denn zurückfinden, wenn um uns herum Ablehnung herrscht und wir schweigen müssen, um nicht irgendwie in unangenehme Situation zu kommen, wie zum Beispiel eben gerade klassisch im Uber, wo der Fahrer mit mir ein Gespräch anfangen wollte und ich dann aber so getan habe, wie wenn ich ein mürrischer Businessman bin, der keine Zeit hat. Also wir leben jetzt wieder in einer Umgebung, wo es zum Teil besser ist, seine Identität zu verschweigen und das ist ja furchtbar.
Also wenn ich an meine Eltern denke, mein Vater hat damals noch gelebt, der ist im Dezember, Ende Dezember 2023 gestorben. Er war 88 Jahre alt und er hat nicht viel gesagt dazu. Aber man hat in seiner inneren Stille und in sich Gekehrtheit in dem Moment, schon gemerkt, wie sehr ihn das mitnimmt. Und trotzdem war er weiterhin sehr stolz und hat ist seiner Aufgabe nachgegangen. Jeden Tag. Nämlich in die Schulen zu gehen und die Geschichte zu erzählen und bei Veranstaltungen dabei zu sein und zu zeigen, dass er Teil dieser Erinnerungsszene und der Szene im Kampf gegen Antisemitismus ist.
Am meisten habe ich mir Sorgen gemacht um meinen jüngsten Sohn. Denn der hat schon sehr aggressiven, verbalen und körperlichen Antisemitismus als Schüler erlebt. Und er hat auch erlebt, wie seine Umgebung, nämlich die Lehrer und die Schulleitung in seiner Schule, sich nicht hinter ihn gestellt haben, sondern ihn da haben im Regen stehen lassen. Und das, das war mir klar, dass das jetzt sofort weitergeht. Und es ist weitergegangen, es hat sich wiederholt an seiner Universität. Die jüdischen Studenten haben sich geweigert. Nicht die Studenten haben sich geweigert, mit jüdischen Studenten zusammen in Arbeitsgruppen zu arbeiten, weil sie Juden waren. Es ging gar nicht darum, ob sie irgendetwas pro israelisches oder wie auch immer gesagt haben. Sie haben einfach kategorisch gesagt: „Wir wollen nicht mit Juden in einer Arbeitsgruppe arbeiten.“ Dieser offene, schamlose Antisemitismus war etwas, was für uns natürlich einerseits schockierend war, weil es eben auch in England so war, in London. Und mein Sohn extra nach London gegangen ist, weil er da dachte: „Okay, also raus aus Berlin. Hier habe ich meine antisemitischen Erfahrungen gemacht. Ich fange neu an als Student nach der Schule in London“. Und da passiert das wieder.
Er hat als Konsequenz daraus nicht versteckt, sondern im Gegenteil, er ist dann an die Uni gegangen, mit dem größten Davidstern, den er finden konnte, und mit einer Kippa auf dem Kopf. Und ist so auch in London, in London durch die U Bahn gefahren. Und dann hat er neue Freunde gefunden. Die jüdischen Studenten haben sich zusammengetan und haben diskutiert, haben gefeiert. Bis heute ist das so. Ich glaube, dass er dadurch eine neue Welt entdeckt hat, die er so hier in Berlin auch nicht hatte. Und das tut ihm gut, diese Solidarität in seinen Kreisen. Aber gleichzeitig wieder ist eben die Frage: Wie lange kann das gut gehen, wenn man sich so absondert und und isoliert?
Mein Vater wurde 1934 geboren in Breslau. Seine Mutter war Jüdin, sein Vater war Katholik. Also er ist in die Nazizeit hineingeboren, als sogenannter „Halbjude“. Es wurde immer schlimmer, bis sie in den Untergrund gehen mussten. Das heißt, sie haben ihre Papiere versteckt oder vernichtet und haben sich dann versteckt. Meine Frau ist Jüdin. Ihre Familie kommt aus Osteuropa, die sind aber schon um die Jahrhundertwende, Anfang des 20. Jahrhunderts nach England und nach Kanada ausgewandert. Also die haben diese schlimmsten Zeiten nur aus der Ferne erlebt. Deren Urgroßeltern haben die Pogrome erlebt, aber sie haben die Nazizeit nicht erlebt. Aber natürlich hat sie die Geschichte der Verfolgung, des Holocaust und der Shoah auch sehr geprägt. Das heißt also, das ist ein ganz bestimmender Teil unserer Familiengeschichte, der so tief ist und dominant und unsere Lebenswege bestimmt, unsere Entscheidungen werden getroffen mit diesem Bewusstsein oder aufgrund dieses Bewusstseins. Das ist nicht etwas, was man irgendwie so abschütteln kann und sagen könnte: „Ach nee, das will ich nicht, das will ich nicht tun.“ Diese Ignoranz führt dazu, dass der Antisemitismus eigentlich nicht aufgearbeitet werden kann.
In der ganzen 1700 Jahre währenden Geschichte der Juden in Deutschland haben ja Juden und Christen eigentlich nebeneinander gelebt und es gab diese Illusion nach dem Ersten Weltkrieg und ja, sagen wir mal seit seit der Gründung des Deutschen Reiches 1870 und so mit der der Zeit der jüdischen Emanzipation, dass ein Zusammenleben möglich ist. Und dieses Zusammenleben wurde zerstört durch die Nazis, also durch die Deutschen in der Nazizeit. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber es gibt immer wieder Ereignisse, die so wie ein Echo sind. Und zerstörerisch war eben auch jetzt in unserer heutigen Zeit. In einer Zeit, in der es so die ersten zarten Ansätze wieder der Annäherung gibt und des Zusammenlebens. In einer Zeit, in der ironischerweise auch zum Beispiel viele Israelis gesagt haben: „Wir wollen nach Berlin ziehen, das ist ja toll, das ist wie Tel Aviv im Norden, und hier können alle zusammenleben.“ Ähm, und in dieser Zeit, in dieser Zeit, ist dieser 7. Oktober reingekracht und die Reaktion so vieler Menschen hat gezeigt, dass dieses zarte erste Zusammensein und Wachsen einer gemeinsamen Kultur zertrampelt worden ist.
Ja, und wir können noch nicht mal sagen jetzt sitzen wir da vor dem Scherbenhaufen und versuchen das irgendwie wieder zusammenzukleben. Denn wir sind mitten in der Zerstörung drin.
Menschenrechtsorganisationen, die haben sehr verhalten auf das Massaker reagiert. Verhalten ist schon fast beschönigend, sie haben eigentlich gar nicht reagiert und sie haben sich aber sofort auf die Seite der Palästinenser geschlagen. Menschenrechte gelten für alle Menschen, überall und immer. Diesen Weg haben sie verlassen und selektiv die Menschenrechte von manchen Gruppen über die anderer gestellt.
Es lag ja alles vor. Man hat alles gesehen auf den Videos. Und trotzdem gab es bei denen, die das hätten sofort anprangern müssen, ein Schweigen. Und mehr noch ein Schweigen in der Menschenrechtsszene war sofort klar: „Das sind die falschen Opfer und sind die falschen Täter.“
Und plötzlich hat man gesagt und das kam sofort, das kam sofort schon am 8. Oktober: „Genozid“. Genozid nicht an den Juden, sondern Genozid an den Palästinensern, bevor überhaupt nur ein Schuss gefallen ist. Also es war schon ganz klar, die Erzählung war schon ganz klar. Von Anfang an, schon am 8. Oktober fing die Täter Opfer Umkehr an. Die Leute, die sich um die Menschenrechte der Palästinenser Sorgen gemacht haben, dass aufgrund des Massakers jetzt Israel unglaublich da reinschlagen wird und hat sofort, sofort darauf aufmerksam gemacht und nicht darauf, dass die Hamas und die anderen Gruppen, die mit Hamas zusammen sich zusammengerottet haben, aber auch ein Großteil, auch das konnte man auf den Videos sehen, ein Großteil der Bevölkerung dieses Massaker begangen hat und dann gefeiert hat. Und es blieb ja auch nicht beim Massaker, sondern es kam dann diese quälenden Geiselnahmen dazu und der Psychoterror, der damit einhergeht. Das war nicht das Thema. Das Thema war „Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jetzt schlägt Israel zu und es wird einen Völkermord geben an den Palästinensern“.
Und die Sprachlosigkeit, die es gab gegenüber dem Massaker, die kam nicht daher, dass das Massaker sprachlos gemacht hat, sondern sie kam daher, dass man dazu nichts sagen wollte.
Der 7. Oktober stellte eins der schlimmsten Menschenrechtsverbrechen dar der letzten Jahre und Menschenrechtsorganisationen, die das natürlich sofort in schärfsten Tönen kritisieren müssen und darstellen müssen und entsprechende Konsequenzen fordern sollten, haben sich zuerst mal in Schweigen gehüllt und wenn es überhaupt irgendwelche Statements dazu gab, erst sehr verzögert Tage oder Wochen später. Eher in Ton von Nachrichtenagenturen, nicht mehr als nur beschrieben, was da passiert ist. Eben dass es da ein Massaker gab. Ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell verändern wird. Aber in dem Umfeld, in dem das jetzt alles stattfindet, das hat auch damit was zu tun, dass sich die Menschenrechtsorganisationen im Allgemeinen eher ideologisch nach links verschoben haben, in den letzten Jahren. Und jetzt ist gerade eben der der ewige Jude ist verkörpert gerade im Staat Israel, also da und hinter dann der vermeintlich harmlosen Israelkritik in Anführungsstrichen, denn man sagt nicht Spanien Kritik und nicht Italienkritik. Aber man sagt Israelkritik. Es gibt nur diesen einen Begriff.
Also in dieser Israelkritik spiegelt sich die Judenfeindschaft, die kulturelle Judenfeindschaft des Westens wider. Insofern ist diese antisemitische Welle, die es jetzt gibt, eine globale Welle. Und ob man jetzt in Toronto oder in New York oder Berlin oder London ist oder Paris, Juden auf der ganzen Welt erleben gerade dasselbe. Also es ist nicht nur mehr Deutschland.
In unserer eigenen Familiengeschichte fängt das an damit, dass die Kinder auf eine jüdische Schule gehen. Der nächste Schritt ist, dass man irgendwann auswandert nach Israel. Mein Vater war elf, als der Krieg vorbei war und Zehn, als sie geflüchtet sind vor der Gestapo, die an der Tür schon geklopft hatten, und durch den Hinterausgang raus. Und da hat er mir erzählt, an meinem Geburtstag, als ich zehn wurde, hat er gesagt, als ich zehn wurde, ist das und das passiert. Und diese Geschichten haben sich natürlich verändert im Laufe der Jahre, je älter ich wurde. Also der Inhalt hat sich nicht verändert. Aber wie die Geschichten erzählt worden sind und es kamen immer mehr Einzelheiten. Also meine Eltern haben das sehr gut gemacht. Das ist sehr, erst sehr kindgerecht erzählt haben und dann später eben gab es dann Diskussionen, Unterhaltungen, Gespräche darüber, die oft bis spät in die Nacht verliefen.
Und mein Vater hat immer mal gesagt „Erzähl das deinen Freunden nicht, denn so wie man sagt, dass man aus einer jüdischen Familie kommt. Werden die komisch, die Leute.“ Aber ich habe gedacht: „Nee, also das mache ich nicht. Ich, ich werde ganz offen darüber sprechen.“ So sieht man, wie eine Demokratie verfallen kann, indem nämlich diejenigen, die noch bei Verstand sind, sich aber nicht trauen und sich dann auch irgendwann anpassen und natürlich auch nicht in dieser Außenseiterrolle verharren wollen. Wir haben das erlebt in verschiedenen geschichtlichen Epochen, in verschiedenen Ländern und ich glaube, wir erleben das jetzt auch.
Und nicht umsonst sagt man Juden sind die Kanarienvögel in der Kohlenmine. Der Gradmesser des Judenhasses und des Antisemitismus ist die Demokratie. Das heißt, da, wo Antisemitismus ansteigt, verliert die Demokratie. Das ist eine Binsenweisheit. Die gibt es seit vielen Jahren. Aber wir erleben das gerade, und das ist immer der erste Schritt hin zu autoritären Strukturen. Deswegen ist der Kampf gegen Antisemitismus nicht einfach nur Kampf gegen Antisemitismus, sondern es ist der Kampf für Freiheit und für Demokratie.
Mein Sohn hat jetzt gefragt, der auf dem Sprung ist nach Tel Aviv zum Praktikum. Der hat gesagt: „Ich will das eigentlich gar. Wann hört das denn mal auf? Ja, ich will auch einfach mal so ganz normal leben.“ Was antwortet man denn da? Also ich habe geantwortet, dass unsere Normalität immer davon beeinflusst wird, aber wir gelernt haben in unserer Kultur und in unseren Familien, wie wir damit umgehen können. Und diese Haltung, das heißt also immer eine gewisse in einer gewissen Gespanntheit sein, bedeutet aber auch, dass das unser Denken anregt und wir natürlich auf diese Fragen Antworten suchen müssen und Antworten finden müssen. Und vielleicht diese Arbeit das ist, was uns erhält und in unserem Dasein weiterbringt.