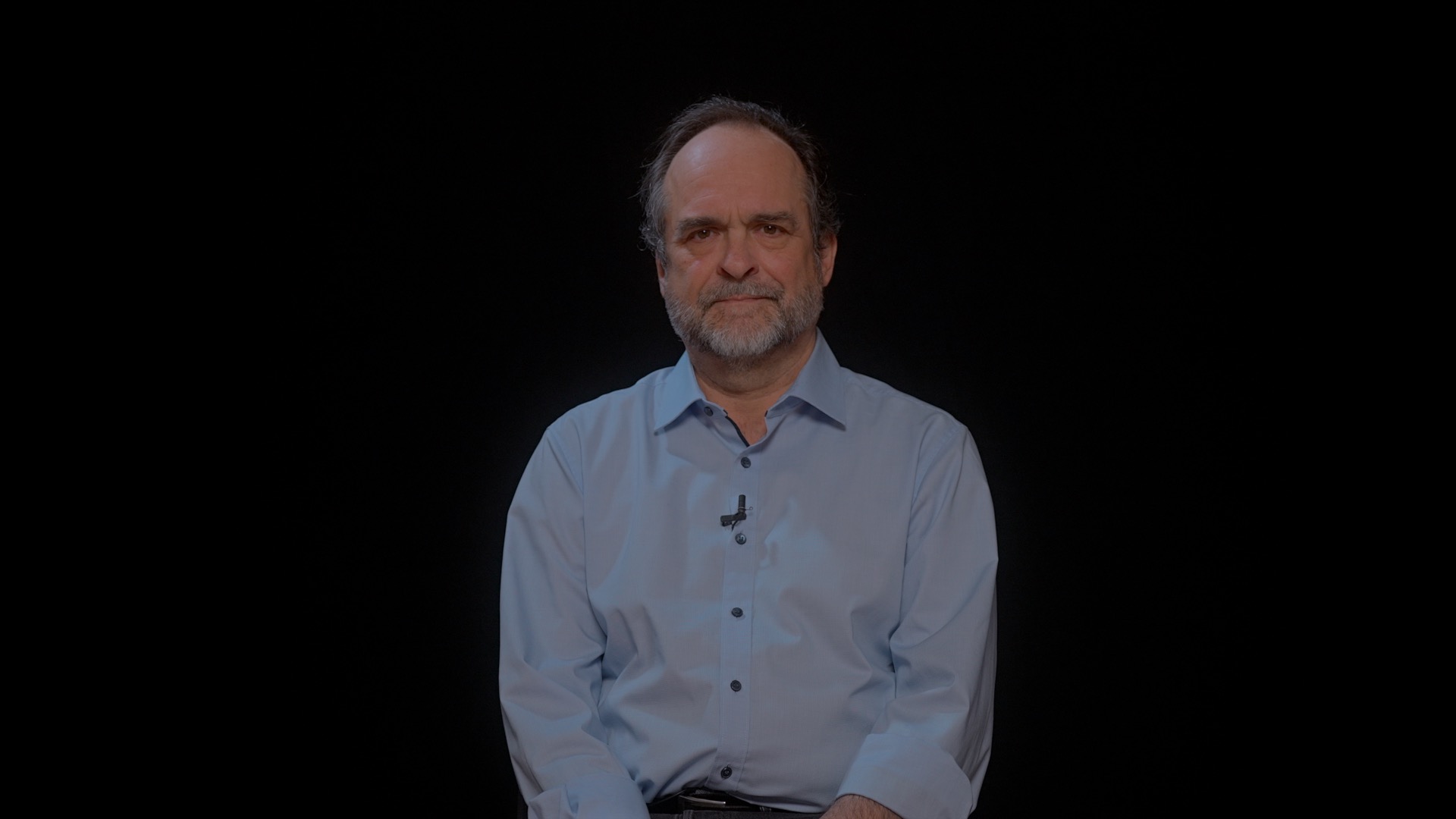Das Projekt KOLOT – קולות – STIMMEN wurde 2024 als dokumentarisches und künstlerisches Vorhaben gegründet. Seither sammelt es Stimmen und entwickelt daraus narrative Videointerviews, die die Folgen der Massaker thematisieren und die Wirkung von Gewalt in jüdischen Biografien nachzeichnen. Die im Rahmen von KOLOT produzierten Videos sind zeitgeschichtliche Zeugnisse jüdischen Lebens in Deutschland nach dem 7. Oktober 2023.
Für die Wiedergabe wird eine stabile Internetverbindung empfohlen.
About
Der 7. Oktober 2023 markiert eine tiefe Bruchstelle für die jüdische Gemeinschaft.
2024 gründete Marina Chernivsky das Projekt KOLOT, mit dem Ziel, ein zeitgeschichtliches Archiv zu entwickeln. In narrativen Videointerviews reflektiert das Projekt die Folgen des terroristischen Angriffs und beleuchtet die Gleichzeitigkeit und Nachwirkungen von Gewalt in jüdischen Biografien.
Das mit dem ELNET Award 2025 ausgezeichnete Projekt KOLOT zählt zu den ersten in Deutschland und Europa, die sich in dokumentarischer und künstlerischer Form mit dem 7. Oktober 2023 und seinen Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft auseinandersetzen.
Die im Rahmen des Projekts entstandenen Videos bilden ein Mosaik persönlicher Erzählungen – individuelle Stimmen, die zugleich kollektive Zeugnisse jüdischen Lebens in Deutschland nach dem 7. Oktober 2023 abbilden.
KOLOT ist aus dem Anspruch der Zeugenschaft heraus entstanden und aus dem Bewusstsein einer Verantwortung: jüdische Stimmen hör- und sichtbar zu machen und sie zu bewahren. Indem den Erfahrungen sprachlich und medial Ausdruck verliehen wird, entsteht ein Akt der Selbstermächtigung.
Eröffnet wurde das Projekt im Oktober 2024 mit einer Auftaktveranstaltung im Jüdischen Museum Berlin. Im August 2025 werden die ersten Interviews erstmals in voller Länge veröffentlicht. Im November 2025 verlieh ELNET den Preis in der Kategorie Kultur an KOLOT.
Die Videointerviews von KOLOT gehen in die Sammlung des Jüdischen Museums Berlin ein. Das Projekt knüpft damit an die Tradition der oral history an, um jüdisches Erinnern als Zeugenschaft und als aktive Praxis festzuhalten.
Geplant sind 20 Videointerviews. Die Fortsetzung des Projekts ist angestrebt.
Das Projekt wird von OFEK e.V. getragen und durch die Förderung des Bundesministeriums des Innern ermöglicht.

Materialien
Mehr Informationen folgen demnächst.
OFEK
Der Trägerverein von KOLOT, OFEK e.V., ist die erste Fachberatungsstelle in Deutschland, die auf Antisemitismus und Communitybasierte Betroffenenberatung bei Gewalt und Diskriminierung spezialisiert ist. OFEK arbeitet bundesweit und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: 1.) fallbezogene Betroffenenberatung, 2.) Stärkung und Empowerment der Community, 3.) antisemitismuskritische Beratung für Institutionen, 4.) Advocacy und fachpolitische Interessensvertretung.
OFEK ist erreichbar über die bundesweite Hotline und verfügt über Beratungsstandorte in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (im Aufbau). OFEK berät vertraulich und kostenfrei zum Umgang mit antisemitischen Vorfällen. Die Beratung von Betroffenen orientiert sich an den fachspezifischen Qualitätsstandards professioneller Opfer- und Antidiskriminierungsberatung. OFEK leistet Beratung zu rechtlichen Möglichkeiten im Umgang mit Antisemitismus, psychosoziale Betroffenenberatung bei Vorfällen und psychologische Beratung und Krisenintervention, fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit und vermittelt bei Bedarf professionelle weiterführende Angebote. OFEK berät ungeachtet der strafrechtlichen Relevanz, stärkt die Ratsuchenden, richtet den Blick auf Handlungsmöglichkeiten und berücksichtigt in der Beratung familienbiografische Erfahrungen mit Antisemitismus und Diskriminierung. Fallbezogene Beratung ist stets parteiisch im Auftrag der Betroffenen und orientiert sich an ihren Wünschen und Bedürfnissen. Alle Angebote können auf Deutsch, Hebräisch, Russisch und Englisch in Anspruch genommen werden.
OFEK bietet darüber hinaus stärkende Gruppenberatung und passgenaue Empowerment-Formate an und leistet Awareness-Begleitung von Veranstaltungen. An Institutionen im Kultur- und Bildungsbereich, Verwaltungen und zivilgesellschaftliche Träger:innen richten sich OFEK-Formate der institutionellen Fachberatung zu Schutzkonzepten, Notfallplänen und Interventionsmanagement sowie zahlreiche Weiter- und Fortbildungsformate.
Mehr zu OFEK:
Presse
Presseanfragen: presse@ofek-beratung.de | +49 176 46 29 46 08
KOLOT in den Medien:
Es braucht nur Mut. Jüdische Allgemeine, 26.11.2025 (Link)
CPPD-Podcastfolge ERINNERUNGSFUTUR: Nicole Schweiß im Gespräch mit Marina Chernivsky. DialoguePerspectives Podcast, 04.09.2025 (Spotify | Apple Podcasts)
Über die Zäsur sprechen. Jungle World, 21.08.2025 (Link)
KOLOT – קולות – Jüd:innen in Deutschland die Stimme(n) zurückgeben. Radio Corax, 07.08.2025 (Link)
Das »Ofek«-Projekt »Kolot« dokumentiert Erfahrungen von Jüdinnen und Juden aus Deutschland nach dem 7. Oktober 2023. Jüdische Allgemeine, 07.08.2025 (Link)
Psychologin: Seit 7. Oktober leben Juden in “paralleler Realität”. Katholische Nachrichtenagentur, 06.08.2025 (Link zum Artikel in der Evangelischen Zeitung)
Projekt „Kolot“: Jüdinnen und Juden erzählen von Erfahrungen nach dem 7. Oktober. Deutschlandfunk/Tag für Tag, 06.08.2025 (Link).
Videoprojekt sammelt deutsch-jüdische Stimmen zum Nahostkonflikt. WDR 3 Mosaik, 06.08.2025 (Link)
OFEK startet Portal mit jüdischen Stimmen zu den Folgen des 7. Oktober. Evangelischer Pressedienst, 04.08.2025 (Link zum Artikel in der Jüdischen Allgemeine)
Gesammelte Stimmen – Projekt „Kolot“ erfasst Zeugnisse zum 7. Oktober. Deutschlandfunk Kultur/Aus der jüdischen Welt, 28.02.2025 (Link)
Impressum
Angaben gemäß §5 TMG
OFEK e.V. Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
Vereinsregister: VR 37581 B
Steuernummer: 27 / 674 / 51693
Veranwortliche im Sinne des Presserechts: Marina Chernivsky
Kontakt:
Tel: +(49) (0) 30 221 84 076
Email: kontakt[at]ofek-beratung.de
Postfach 58 03 16
10413 Berlin
Vertretungsberechtigte Personen im Vorstand/Geschäftsführung:
Marina Chernivsky, Vorstand und Geschäftsführung
Tel: (+49) (0)176 22508407
Email: chernivsky[at]ofek-beratung.de
Postfach 58 03 16
10413 Berlin
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutzerklärung
Stand: 17. Juni 2025
Verantwortlicher
OFEK e.V. Beratungstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
Vereinsregister: VR 37581 B
Umsatzsteuer-Indentifikationsnummer: 27 / 674 / 51693
Postfach 58 03 16
10413 Berlin
Vertretungsberechtigte Personen: Geschäftsführung: Marina Chernivsky
E-Mail-Adresse: kontakt[at]ofek-beratung.de
Telefon: (+49) (0)30 221 84 076
Kontakt Datenschutzbeauftragter
datenschutz@ofek-beratung.de
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Diese Internetseite verwendet teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Mithilfe des Cookie-Banners können Sie sich zu Beginn Ihres Besuchs und jederzeit über die von uns und unseren Dienstleistern eingesetzten Cookies informieren und einstellen welche Cookies verwendet werden dürfen bzw. Ihre Einwilligung zum Einsatz von Cookies erteilen, soweit dies rechtlich erforderlich ist.
Außerdem können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Internetseite eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Grund des berechtigten Interesses des Anbieters gespeichert. Der Anbieter hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.
Datenverarbeitung im Rahmen von Presseanfragen und allgemeinen Anfragen
Zur Beantwortung von Presseanfragen an presse[at]ofek-beratung.de und allgemeinen Anfragen an kontakt[at]ofek-beratung.de verarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten um Kontakt mit Ihnen herstellen und Ihre Fragen beantworten zu können:
- Namen
- Adressen, Telefonnummern
Wir verarbeiten diese Daten auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO da es in unserem berechtigten Interesse liegt Öffentlichkeitsarbeit im direkten Kontakt mit entsprechend interessierten Stellen zu betreiben.
Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Rahmen können Sie jederzeit widersprechen. Dafür stehen Ihnen die oben angegebenen Kontakte zur Verfügung.
Die Daten werden gelöscht sobald Ihre Anfragen umfassend beantwortet worden sind.
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
- Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles: Der Zugriff auf unser Onlineangebot wird in Form von sogenannten „Server-Logfiles“ protokolliert. Zu den Serverlogfiles können die Adresse und der Name der abgerufenen Webseiten und Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmengen, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und im Regelfall IP-Adressen und der anfragende Provider gehören. Die Serverlogfiles können zum einen zu Sicherheitszwecken eingesetzt werden, z. B. um eine Überlastung der Server zu vermeiden (insbesondere im Fall von missbräuchlichen Angriffen, sogenannten DDoS-Attacken), und zum anderen, um die Auslastung der Server und ihre Stabilität sicherzustellen; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) am sicheren Betrieb des Onlineangebots. Löschung von Daten: Logfile-Informationen werden für die Dauer von maximal 30 Tagen gespeichert und danach gelöscht oder anonymisiert. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
- 1&1 IONOS: Leistungen auf dem Gebiet der Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur und verbundenen Dienstleistungen (z. B. Speicherplatz und/oder Rechenkapazitäten); Dienstanbieter: 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) an der technischen Bereitstellung des Onlineangebots; Website: https://www.ionos.de; Datenschutzerklärung: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy. Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.ionos.de/hilfe/datenschutz/allgemeine-informationen-zur-datenschutz-grundverordnung-dsgvo/auftragsverarbeitung/.
Rechte der betroffenen Personen
Rechte der betroffenen Personen aus der DSGVO: Ihnen stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbesondere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben:
- Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
- Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.
- Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
- Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
- Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu fordern.
- Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Vorgaben der DSGVO verstößt.
Änderung und Aktualisierung
Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z. B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.
Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von Unternehmen und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die Adressen sich über die Zeit ändern können und bitten die Angaben vor Kontaktaufnahme zu prüfen.
Eigentlich fühlt sich die vielleicht das ganze erste halbe Jahr seit dem 7. Oktober an wie ein langer, monotoner Tag. So würde ich die, so würde ich den 7. Oktober und die Zeit danach ganz persönlich emotional beschreiben. Ich glaube, dass diese Zeit nach dem 7. Oktober wie so eine Zeit des Trauerns war, in der vieles völlig unklar war und gleichzeitig vieles völlig klar. Klar, dass die Welt, in der wir leben, nicht mehr die gleiche ist, vielleicht auch nie wieder die gleiche sein wird.
Ich erinnere mich aber dennoch sehr gut an die ersten Stunden dieses Tages, weil ich weiß, dass ich mich eigentlich, ich war alleine und ich weiß, dass ich mich eigentlich kaum bewegt habe, sondern die ganze Zeit eigentlich nur in so einer Starre mich befunden habe und eigentlich nur auf mein Telefon geguckt habe. Und am 7. und 8. Oktober war noch überhaupt nicht klar, ob das eine anhaltende, wie lang diese Situation, die anhaltenden Massaker, Terroristen in Israel und auch die Bedrohungen, die sich sozusagen sofort auch übertragen hat in uns, aber auch in einem tatsächlichen Sinne, in Bedrohungsgebärden, in vermeintlichen Nachrichten, die jüdische Personen erreicht haben, in Chatgruppen, in sozusagen auch dieser Multiplikation der Sorge, in Resonanz miteinander und so dieses Suchen, was passiert uns gerade in Nachrichten, in Telefonaten ständig hin und her ging. Aber ich erinnere mich, dass ich die ersten 24 Stunden eigentlich nur alleine sein wollte. Also ich wollte. Das hat sich dann sofort aufgelöst in so einem Gefühl von: Ich will überhaupt nicht mehr alleine sein, das weiß ich noch.
Aber in den ersten 24 Stunden hatte ich das Gefühl, wenn ich sozusagen zu nahe jetzt in Resonanz trete, dann weiß ich überhaupt nicht, ob sich, ob ich mich überhaupt noch emotional in meinen eigenen Grenzen halten kann. Was etwas ist, was ich eigentlich nicht gewöhnt bin. In einer Wahrnehmung von diesen ersten katastrophalen und schrecklichen und überdimensionierten und perversen und gewaltvollen Bildern, die eigentlich nur aus einem Kontext der Diaspora bekannt waren, aus einem Kontext der Verfolgung der familiären Überlieferungen. Einen weiteren etwas, etwas weiteres, was ich sofort gemerkt habe, ist und das ist mir so eigentlich auch nur in ganz wenigen Momenten in meinem Leben passiert, dass ich das Gefühl hatte, wir machen wie eine körperliche Phantomerfahrung.
Aber ich weiß noch genau, als ich das erste Video gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, ob es Naama Levy war oder Shani Louk. Als ich diese beiden ersten Videos gesehen habe, wusste ich Ah, hier geht es auch noch mal um eine Ebene, die wir so in einer kontemporären Form noch nicht gesehen haben. Und das ist die Ebene der zielgerichteten Gewalt gegen Frauen, deren Motiv Antisemitismus ist. Und das war etwas, von dem ich im ersten Moment dachte Ich, wusste in diesem Moment nicht, ist das eine, ist das etwas, was für immer in meinem Körper bleibt? Und es geht vielleicht auch gar nicht darum, etwas zu machen. Was nur so unglaublich war, war eben dieses Geschehen in diesem über diese digitale Ebene zu bezeugen und gleichzeitig das Gefühl zu haben, irgendwie in diesem Erleben mit drin zu stecken. Und das war neu. Das war präzedenzlos in meinem Leben und hat aber gleichzeitig an etwas angeschlossen, wovon ich mir auch nie hätte vorstellen können, dass es mir passiert, nämlich an diffuse und an abstrakte und auch fast schon anekdotische Erzählungen, die es in meiner Familie über das Überleben meiner Großeltern gab.
Es gab auch Menschen, mit denen ich überhaupt nicht sprechen konnte. In so einem fast diametralen Kontrast stand zu einer sehr engen, langjährigen nichtjüdischen Freundin, die ich eigentlich immer als politisierte Person wahrgenommen habe, die eine politisierte Person ist. Sie hat es nicht vermittelt, aber das Gefühl wurde in mir hervorgerufen, dass ich dachte, Ich wusste nicht, dass wir in zwei so unterschiedlichen Welten leben können, im gleichen Moment. In einer Welt, in der Sie und ich und jüdische Personen, Jüdinnen und Juden glauben, dass sie sterben. Dieses Erleben war so krass, dass ich, ich glaube Wochen gebraucht habe, um ihr auf ihre wiederkehrenden Nachrichten auch zu antworten. Ich dachte wie kann es sein, dass Menschen, die damit nicht gemeint sind, dass Leben einfach weitergeht und für uns nicht?
Meine Geschichte, also die Geschichte meiner Existenz, die beginnt in Israel. Meine Mutter ist in einer bayerischen Kleinstadt geboren, als erstes Kind von vier oder als letztes Kind von vier, das in Deutschland geboren wurde. Und dort aufgewachsen, isoliert, als jüdische Familie, isoliert, als Kind von Shoahüberlebenden. Ihre Geschwister waren geboren in Israel, also im gerade entstandenen, gegründeten Israel. Der weitere ältere Bruder in einem Zug zwischen Polen und Russland und die älteste Schwester in Taschkent in Usbekistan. Das heißt, meine Mutter ist geboren worden als jüngstes Kind einer Familie, von der kein Kind im gleichen Land unter gleichen Umständen geboren wurde. Als Kind von zwei polnischen Juden, die den Krieg in Russland überlebt haben, in einem, unter anderem in einem Arbeitslager in Sibirien. Deren Familien nahezu vollständig ausgelöscht wurden. Ermordet irgendwo zwischen dem Schtetl, aus dem sie kamen, das es nicht mehr gibt, dem Warschauer Ghetto und Treblinka.
Die Familie meiner Großmutter ist tatsächlich vollständig ermordet worden. Meine Großmutter war die einzige Überlebende ihrer Familie, als jüngstes Kind. Das hat sie auch bis an ihr Lebensende begleitet und auch unser Leben maßgeblich geprägt, das ihrer Kinder und Enkelkinder. Und in diesem Verständnis, das Jüdischsein bedeutet zu überleben, einer Welt anzugehören, die es nicht mehr gibt. Dass diese Welt eigentlich nur in den vier Wänden zu Hause fortgesetzt wird und alles, was draußen passiert, einfach der, also das krasseste Gegenteil ist, wie es sein kann. Zu Hause gab es eben noch diese, diese alte Welt. Zu Hause wurde Jiddisch gesprochen, wurden andere Dinge gegessen, zu Hause wurde geweint, zu Hause wurden Witze erzählt. Zu Hause war alles anders als in dieser bayerischen Kleinstadt draußen, weil draußen wurde bayerisch gesprochen. Draußen waren die Juden etwas anderes als zu Hause. Draußen war das Täterland, und zwar völlig ungefiltert. Und draußen war ein Zufall. Draußen war eine Zwischenstation. Draußen war nicht: Hier wollen wir unsere Kinder großziehen, sondern draußen war besser als das, was davor war. Gerade so. Draußen war das, was gerade noch ging.
Ideal wäre für meine Großmutter gewesen, nach Israel zu gehen. Deshalb ist auch mein Onkel in Israel geboren. Weil das eigentlich, wenn ich rückblickend auf das Leben meiner Großmutter schaue, das einzige gewesen, was sie, was ihr auch nur in Ansätzen hätte, irgendeine Form von teilweiser Heilung hätte geben können. Das war in ihrem Selbstverständnis so, dass man Jüdischsein mit dieser vernichteten Familie eigentlich nur noch im Kollektiv sein konnte. Und das hatte nicht nur etwas sozusagen mit der ideellen Aufladung des neugegründeten Israels zu tun, sondern das hatte auch etwas mit ihrer Erziehung zu tun. Das hatte etwas damit zu tun, dass in ihrer Familie, ihre Familie einerseits streng orthodox war und auf der anderen Seite es natürlich diese Modernisierungsbestreben gab. Es gab die zionistische Jugendbewegung, es gab diese Idee davon, dass es etwas, dass es ein neues jüdisches Selbstverständnis gibt, in der man, in dem man aufbricht und sozusagen dieser Fremdbestimmung des Schtetls und auch dieser Vergangenheit entflieht und sozusagen der neue Jude wird. Das gab es, das hat meine Großmutter auch immer so sehr plastisch erinnern können. Wir haben auch irgendwann mal Fotos gefunden von diesen, von den Abschiedsfeiern der Abiturient:innen, die dann aufgebrochen sind nach Palästina. Das steht dann drunter in einem Banner auf Jiddisch. „Zur Abfahrt nach Palästina.“ Und die Menschen, die es nach Palästina geschafft haben, die sind nicht umgebracht worden. Und alle anderen eben schon.
In einer Familie wie unserer, in der dieses eine Trauma, es ist natürlich nicht nur eins, sondern es sind, wir können es jetzt nur im Nachgang sozusagen das eine Trauma nennen, aber es sind natürlich so viele Dinge und ich habe, glaube ich, erst durch meine Arbeit verstanden, dass das gar nicht etwas ist, was in unserer Familie so etwas Besonderes ist, sondern auch etwas ist, was das Erleben der Kinder von Shoa-Überlebenden sehr stark geprägt hat und deshalb zum eigenen Gefühl irgendwie oder zum Kontakt, zum eigenen Gefühl, eine Schwierigkeit besteht und somit sind ist es manchmal schwer, über sehr, sehr schwerwiegende Ereignisse wie Trauer oder Dinge, die einen erschrecken, Dinge, die einen wütend machen, Dinge, die einen erschüttern, gemeinsam emotional in Kontakt zu treten, weil das sozusagen meine persönliche Form des Umgangs geworden ist, auch wenn ich emotional erstarre, kann ich sozusagen, habe ich für mich gelernt zu kanalisieren, zu verstehen, was mir passiert, indem ich verstehe, was in der Welt passiert. Das ist das eine. Also diese Ebene der Sorge um die Geschehnisse in Israel waren die eine Ebene, die für Jüdinnen und Juden, weil sie kollektiv verbunden sind, aber eben auch ganz persönlich biografisch. Jüdinnen und Juden in einen Ausnahmezustand versetzt hat.
Und die zweite Ebene war aber eben das Gefühl, in einem völligen Paralleluniversum zu leben, in einem, in einer Welt, in einem Umfeld, in einer Umwelt, in einem nicht vorhandenen Resonanzraum, in dem das Eigene, die Rezeption, die eigene Rezeption dessen, was da passiert, was sich nicht nur in Israel abgespielt hat. Aber bleiben wir jetzt mal nur bei den Geschehnissen in Israel, die diese, es kein Resonanzraum für dieses Erleben gibt. Aber ja dann auch noch auf einer dritten Ebene den 7. Oktober, den 7. Oktober, nicht den darauffolgenden Krieg des israelischen Militärs im Gazastreifen gegen die Hamas, sondern der 7. Oktober, der Anlass und Amplifizirungspunkt für einen sich bahnbrechenden Antisemitismus. Weil ich es vielleicht erklären kann und trotzdem nicht begreife, wie der Anlass, diese Massaker, diese ideologisch antisemitisch aufgeladenen Massaker als Anlass für einen sich, für eine weltweite Welle antisemitischer Gewalt.
Und ich hatte aber das Gefühl, dass sozusagen das, was wir schon kannten, also diese ständige, diese ständige, der banale Begleiter, der einen immer irgendwo in wirklich den. So profan gesagt most random Situationen in den willkürlichsten, absurdesten Situationen begegnet, also auch in Situationen, in denen man sie wirklich nicht erwartet. Wie ich weiß nicht: In der Bar, auf ein Date, in einem Club, auf einer WG Party. Ich nenne jetzt vor allem eben so informelle Räume, informelle Räume, in denen sich Menschen eigentlich nur privat fühlen wollen und im Zweifel auch gar nicht jüdisch fühlen wollen, sondern vor allem lebendig fühlen wollen. Als Teil, als Teil von anderen fühlen wollen. Als ein Kollektiv, in dem es nicht darum geht, wer verschieden ist, sondern vor allem sind irgendwie alle irgendwie ähnlich, gleich gesinnt. In kulturellen Kontexten, in künstlerischen Kontexten.
Und das Gefühl, glaube ich nach dem 7. Oktober war das sozusagen diese intimen Räume, dass in diese intimen Räume, noch stärker eingedrungen wurde, also dass man sozusagen noch weniger sicher war und die antizipierte Bedrohungslage irgendwie noch noch näher gekommen ist, auch wenn sie sich nicht ausagiert hat. Jede alltägliche Situation war plötzlich ein möglicher Anlass und etwas, was ich nicht nur bei mir selber, also was ich tatsächlich bei mir selber auch auf eine bisher mir nicht bekannte Intensität in einer mir bisher nicht bekannten Intensität erlebt habe, aber eben auch wirklich in einem erweiterten Umfeld, dass ich nicht nur auf Deutschland begrenzt hat. Und davon sind wirklich, glaube ich auch zum Beispiel Verwandte von mir im Ausland, also im nicht israelischen Ausland, überrascht worden. Dass sie das erleben, ist ein sozusagen nicht nur eine Befürchtung als Begleiter, sondern tatsächlich auch eine Paranoia als Begleiter.
Das war insbesondere in der Zeit unmittelbar nach dem 7. Oktober, als es noch diese Nachrichten vom Tag des Zorns gab, an dem es dann die Deklarationen gab, jetzt würden eben nach dem Anschlag, den Anschlägen in Israel auch jüdische Institutionen weltweit angegriffen werden, was beispielsweise für meine Familie in Argentinien gar nicht so weit hergeholt ist. Weil in Buenos Aires 92 und 94 auch jeweils die israelische Botschaft und das Amir Gemeindezentrum in die Luft geflogen sind.
Das heißt die Antizipation, dass es einen politisch ideologisch terroristisch motivierten Angriff auf Jüdinnen und Juden in der Diaspora geben könnte, als Folge eines eines bereits deklarierten terroristischen Machtaktes, der der 7. Oktober ja war, überhaupt nicht weit hergeholt war, dass genau so etwas passieren kann, dass uns jetzt die jüdischen Einrichtungen um die Ohren fliegen, weil ja unmittelbar nach dem 7. Oktober auch noch die Frage bestand: Inwiefern potenziert sich auch dieser Gewaltakt der sexualisierten Gewalt gegen jüdische Frauen als potenzielles, als potenzielles Ziel? Inwieweit potenziert sich das auch jetzt in unserer Lebensrealität?
Und das hat sich ja nicht nur ausagiert in der Form, in der direkten Reaktion auf das, was am 7. Oktober passiert ist, sondern eben auch wiederum übersetzt in ein Gefühl, in der die Frage bestand, ob man überhaupt noch sicher ist, in der die Frage bestand, ob ich als jüdisch, als Frau gelesene Person, als Frau, als jüdische Frau mich überhaupt noch sichtbar machen darf im öffentlichen Raum. Ich mache mich sichtbar im öffentlichen Raum. Aber kann ich, bedeutet das, dass ich in meinem privaten Umfeld nicht mehr sicher bin? Kann ich überhaupt noch jemanden in meinen privaten Raum reinlassen? Jemand Neues?
Hier hat etwas glaube ich stattgefunden, was so seit der nicht nur seit der Gründung des Staates Israel, sondern auch seit der Entstehung des israelischen Selbstverständnisses, der israelischen Identität, so in einer Resonanz zwischen Israelis und in der Diaspora lebenden Jüdinnen und Juden, seit der Staatsgründung nie geschehen ist, seit der Staatsgründung und der Shoah, also in der zeitlichen Nähe zueinander, also von Israelis, die plötzlich nicht nur den Impuls hatten, weil ich glaube, den hatten einige und sind dann doch geblieben, den Impuls hatten zu fliehen und Menschen aus der Diaspora, die das Gefühl hatten, fliehen zu müssen.
Aber ich glaube, was noch viel zentraler ist, ist, dass es, glaube ich, zum Ersten Mal über diese genozidale Botschaft, die adressierte Gewalt, plötzlich ein anderes oder ein neues Kollektivverständnis darüber gab, was es bedeutet, als Jude markiert zu werden. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was wir als Konzept in der Tiefe nicht verstanden haben aus der Shoah. Also sozusagen wie eine Gruppe, die sich vielleicht bis zu dem, Ich bin keine Historikerin, ich kann das nicht an einem Punkt festmachen, ob das die, ob das die Nürnberger Rassengesetze waren oder die Endlösung oder die ersten Deportationen oder die Novemberpogrome. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht sagen, weil ich dazu kein hinreichendes Wissen habe, aber auch kein hinreichendes Verständnis um diese Dynamiken, wie sie sich zugetragen haben.
Aber ich glaube, was wir wahrscheinlich bis heute nicht begreifen können, ist wie eine extrem heterogene Gruppe, die sich zu dieser Zeit vielleicht gar nicht als Kollektiv verstanden hat, zu einem Kollektiv gemacht wurde. Und ich glaube, das ist so ein Konzept in dieser kollektiven Sekundärtraumatisierung, wie wir sie in der Diaspora erlebt haben, in Resonanz zu dem, was Israelis auch passiert ist, die vielleicht gar nicht primär betroffen waren, aber natürlich als israelisches Kollektiv getroffen wurden, durch den 7. Oktober, plötzlich vielleicht gemeinsam auf einer neuen Ebene verstanden haben. Was es bedeutet, zum Juden gemacht zu werden, der eine zentrale Marker oder das eine Zentrale erleben, dass Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt mit Israelis teilen, ist das Schicksal der Geiseln.
Weil also zum einen ist es so, dass wie durch eine, also fast schon einen sich automatisierenden Aktionismus das Schicksal der Geiseln der zivilen Geiseln, jüdische Gemeinden auf der ganzen Welt aktiviert hat, sie dazu bewegt hat, vor Botschaften zu demonstrieren in Innenstädten, aber auch nur sie. Also das hat der natürlich nicht zu Massendemonstrationen oder sonstigem geführt, sondern wirklich als ein absolut partikulares Thema. Das allerdings, ich glaube, es gibt keine jüdische Gemeinde, in der es nicht ein Bring them Home Banner gibt oder in der die Bilder der Geiseln nicht aufgehängt sind, also auch auf wirklich eine brutale und fast schon antiästhetische Art und Weise, also wirklich eindringend in Räume, die eigentlich gar nicht dafür gedacht sind, zu Gedenkorten zu werden. Diese Figuren, von denen nicht klar ist, ob sie am Leben sind oder nicht, die dann vor dieser antisemitischen Propaganda Kulisse Anfang des Jahres nach und nach einige von ihnen lebend, einige nicht, freigelassen wurden und ich erst verstanden habe: Wir müssen uns sozusagen auch den wir befinden uns auch in einem Transitraum des Gedenkens. Wir befinden uns in einem in einer Situation, in der wir für uns begreifen müssen, wie wir das Kollektiv überhaupt verarbeiten sollen, dass es eigentlich nur uns emotional tangiert.
Und ich glaube aber, dass wir uns nach wie vor in diesem Transitraum befinden. Denn natürlich passiert der Krieg im Gazastreifen, die anhaltende Geiselkrise, ein nicht enden wollender Krieg, eine Regierungskrise und die Frage, ob der sogenannte israelisch palästinensische Konflikt in irgendeiner Form gelöst wird, natürlich nicht in einem Vakuum, sondern er passiert in einer Zeit, in der autoritäre Kräfte im Westen Wahlen gewinnen. Demokratische Wahlen gewinnen. Das, was ich sehe, war eigentlich, seitdem ich mich als politisierte Person verstehe, immer von integrierten Gleichzeitigkeiten durchzogen. Es gibt den gemeinsamen Nenner dass es einen Bezug gibt, der uns in Resonanz setzt zu Israel als jüdischem Staat, als jüdisches Kollektiv, unte der Bedingung bestimmter Werte. Diese, also diese Auseinandersetzungen auf einer bilateralen Ebene, haben mich sozusagen darin gefordert, das von mir als selbstverständlich Verstandene, Empfundene, Erlernte immer wieder aufs Neue zu überprüfen und zu hinterfragen. In dieser Entwicklung oder in dieser eigenen, in diesem eigenen Anspruch oder dem Versuch, Dinge zu verstehen, war mir aber eine Sache, mir persönlich, ich kann das für niemanden sonst sagen, mir persönlich war es wichtig, in der Lage zu sein, sich auch gegenüberstehende Narrative auf irgendeine Form zu integrieren. Sogar in der Ambivalenz, sogar im Schmerz und im Widerspruch und in der Wut und in der und in einem schwer aushalten können einer einer Erzählung, die vielleicht dem wirklich diametral gegenübersteht, was ich gelernt habe, was mir erzählt wurde, was mir vermittelt wurde, was wir uns wünschen. Mit diesem Versuch der Integration, dieser Narrative blicke ich, auf diesen anhaltenden Konflikt.
Ich glaube, das ist sehr, sehr lange dauern wird, bis wir einen Raum haben werden, das sozusagen zu bearbeiten. Und der Weg, den ich für mich persönlich gefunden habe und ich für mich persönlich nach wie vor suche, ist der Weg, auf einer völlig geschützten, privaten, nichtöffentlichen Ebene mit anderen Betroffenen zu sprechen. Betroffenen, die nicht jüdisch sind, sondern Betroffenen, die palästinensische Herkunftsbiographie haben. Und damit sozusagen mit allen Ambivalenzen und auch Streit und Wut und auch Schweigen und nicht miteinander sprechen. In Kontakt zu bleiben war für mich eine sehr zentraler Verarbeitungsebene.